
Das Zoll-Paradoxon: Warum Trumps oft abgelehnte Strategie immer noch starke Unterstützer hat – und was sie sehen, was andere nicht sehen
Das Zoll-Paradoxon: Warum eine oft abgelehnte Strategie immer noch starke Befürworter hat – und was diese sehen, was andere nicht sehen
In den elitären Kreisen der Wirtschaftswissenschaft und der Politik-Think-Tanks erntet kaum ein Argument so viel kollektives Augenrollen wie die Vorstellung, dass Zölle die amerikanische Produktion ankurbeln könnten. Der Konsens ist so stabil wie breit gefächert: Zölle erhöhen die Preise, verlangsamen das Wachstum, laden zu Vergeltungsmaßnahmen ein und erreichen selten – wenn überhaupt – ihre erklärten Ziele. Und doch ist ein kleiner, aber entschlossener Kreis innerhalb des politischen Umfelds von Präsident Donald Trump nicht überzeugt.

Sie setzen nicht nur verstärkt auf Zölle – sie versuchen, die Spielregeln komplett neu zu schreiben.
„In den Augen vieler Ökonomen ist dies eine politische Sackgasse“, sagte ein Analyst, der institutionelle Investoren berät. „Aber für diese Gruppe setzt man nicht auf die Lehrbuchtheorie, sondern auf die Nutzung einer einzigartig amerikanischen Hebelwirkung und ein Timing, das günstiger sein könnte, als Kritiker zugeben.“
Während die USA ihre nächsten Schritte auf der Weltbühne abwägen und Trumps Wirtschaftsprogramm in der politischen Sphäre wieder an Bedeutung gewinnt, stellt sich eine provokante Frage: Könnte eine Theorie, die die meisten Experten ablehnen – sorgfältig kalibrierte Zölle als Mittel zur nationalen wirtschaftlichen Wiederbelebung – unter bestimmten, engen Bedingungen tatsächlich funktionieren?
Gegen den Strom: Das strategische Zollargument
Während die breitere Wirtschaftsgemeinde Zölle als ein stumpfes Instrument mit mehr Kollateralschäden als Nutzen ansieht, befürwortet Trumps Kreis einen differenzierteren Ansatz – der in einer obskuren, aber wirkungsvollen Wirtschaftstheorie wurzelt.
Im Zentrum der Strategie steht die Theorie des optimalen Zolls, eine Idee, die nur dann Sinn macht, wenn sie von Ländern mit ausreichender Marktmacht eingesetzt wird.
Die Theorie des optimalen Zolls besagt, dass ein großes Land, das in der Lage ist, die Weltpreise zu beeinflussen, seine nationale Wohlfahrt verbessern kann, indem es einen bestimmten Zoll erhebt. Dieser Zoll wirkt, indem er die Terms of Trade des Landes verbessert (wodurch Importe relativ billiger werden), obwohl dieser Vorteil gegen die verzerrenden Auswirkungen des Zolls abgewogen werden muss.
Die Vereinigten Staaten passen als weltweit größter Importeur in dieses Bild. Die Theorie besagt, dass ein dominanter Käufer wie die USA durch die Erhebung eines Zolls ausländische Lieferanten effektiv dazu zwingen kann, ihre Preise zu senken, um den Zugang zum lukrativen amerikanischen Markt zu erhalten.
Übersicht über den Anteil der Vereinigten Staaten an den globalen Warenimporten in den letzten Jahrzehnten
| Jahr | US-Anteil an den globalen Warenimporten | US-Importwert (Waren) | Globaler Importwert (Waren) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | ~15 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | WITA |
| 2019 | ~9 % | 2,5 Billionen USD (ca.) | Nicht angegeben | WITA, U.S. Census Bureau/BEA |
| 2022 | 14,6 % | 3,37 Billionen USD | ~23 Billionen USD | TrendEconomy, Wikipedia, Weltbank |
| 2023 | 13,1 % - 14,6 % | 3,11 - 3,2 Billionen USD | ~21 - 24,2 Billionen USD | Visual Capitalist, TrendEconomy, OEC, WTO |
| 2024 | ~13,8 % | 3,3 Billionen USD | ~23,9 Billionen USD | Statista, WTO, Weltbank |
„Es geht darum, die Last des Zolls zu verlagern“, sagte ein Makrostratege, der mit internen politischen Diskussionen vertraut ist. „Wenn ausländische Unternehmen einen Teil der Kosten tragen, bleibt dieses Geld in der US-Wirtschaft, anstatt abzufließen.“
Stephen Miran, ein Ökonom, der diese Ansicht vertritt, hat akademische Forschung zitiert, die darauf hindeutet, dass ein Zoll von rund 20 % – theoretisch – die Terms of Trade optimieren, die heimische Industrie stärken und Einnahmen generieren könnte. Diese Einnahmen könnten, wenn sie klug reinvestiert werden, den industriellen Aufschwung finanzieren, von dem Kritiker des freien Marktes behaupten, dass Zölle ihn zerstören.
Verlagerung durch Design, nicht durch Zufall

Ein zweites Standbein des Arguments beruht auf Anreizen zur Rückverlagerung. Durch die Erhöhung des relativen Preises von Importen verringern Zölle die Offshoring-Arbitrage, die die US-amerikanische Produktion seit Jahrzehnten aushöhlt.
Tabelle mit einer Zusammenfassung der Unterschiede und Dynamiken von Rückverlagerungs- und Offshoring-Arbitrage.
| Aspekt | Offshoring-Arbitrage | Rückverlagerungs-Arbitrage |
|---|---|---|
| Kostentreiber | Nutzt niedrigere Arbeits- und Produktionskosten im Ausland | Konzentriert sich auf die Reduzierung versteckter Kosten (z. B. Transportverzögerungen) |
| Risiken | Unterbrechungen der Lieferkette, geopolitische Instabilität | Höhere Anlaufkosten, Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften |
| Marktnähe | Betriebsstätten weit entfernt von den Hauptmärkten | Betriebsstätten näher an den Hauptmärkten |
| Qualitätskontrolle | Potenziell schwächer aufgrund der Entfernung | Verbesserte Qualitätskontrolle aufgrund der Nähe |
| Strategischer Fokus | Nutzt Lohnunterschiede zwischen Ländern | Verbessert die Reaktionsfähigkeit und die Marktanpassung |
Dave Brat, ein ehemaliger Kongressabgeordneter und Wirtschaftsprofessor, hat diese Ansicht öffentlich verteidigt und Zölle nicht als Selbstzweck, sondern als Katalysatoren dargestellt, die „das Kapital zurück in die Hände der Amerikaner legen“. Der beabsichtigte Effekt ist, Geschäftsentscheidungen in Richtung heimische Produktion zu lenken – nicht durch Mandate, sondern durch Marktsignale.
„Wenn Offshoring Sinn machte, als die Arbeitskräfte billig und die Importe reibungslos waren, was passiert, wenn sich diese Kalkulation ändert?“, fragte ein politischer Insider. „Man bekommt heimische Investitionen. Das ist der Plan.“
Diese Theorie der preisdifferenzinduzierten Rückverlagerung hängt von mehr als nur Zöllen ab. Der Erfolg hängt von ergänzenden Maßnahmen ab: Steueranreize, Ausbildung der Arbeitskräfte, Infrastruktur und Forschung und Entwicklung. In diesem Modell sind Zölle keine protektionistischen Relikte – sie sind strategische Anstöße, die in einen größeren industriellen Entwurf eingebettet sind.
Warum das funktionieren könnte – auch wenn es wahrscheinlich nicht funktioniert
Man sollte sich nicht täuschen: Selbst Befürworter räumen ein, dass die Bedingungen für einen Erfolg eng gesteckt sind. Die Strategie beruht auf einem Zusammenfluss von wirtschaftlicher Macht, politischem Willen und globaler Zurückhaltung, der selten ist – und vielleicht auch nur von kurzer Dauer.
1. Marktmacht in einer multipolaren Welt
Die USA sind immer noch für fast 15 % der weltweiten Importe verantwortlich. Wenn eine Nation als Käufer Bedingungen diktieren kann, dann sind es die Vereinigten Staaten. Ein richtig festgelegter Zoll könnte Exporteure dazu zwingen, die Preise zu senken, insbesondere wenn sie stark von der US-Nachfrage abhängen.
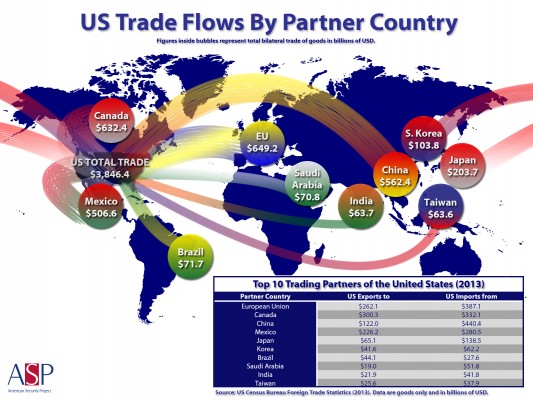
2. Einnahmen für strategische Reinvestitionen
Zölle sind funktional Steuern. Aber im Gegensatz zu Einkommenssteuern werden sie auf ausländische Unternehmen erhoben. Wenn diese Erträge in strategische Initiativen gelenkt werden – saubere Energie, Halbleiter, digitale Infrastruktur –, könnten sie sowohl als Abschreckungsmittel als auch als Entwicklungsinstrumente dienen.
Jährliche US-Zolleinnahmen in den letzten Jahren
| Geschäftsjahr | Zolleinnahmen (Milliarden USD) |
|---|---|
| 2024 | 88,07 |
| 2023 | 80,0 |
| 2022 | 111,8 |
| 2021 | 93,8 |
| 2020 | 78,8 |
| 2019 | 71,9 |
3. Produktion als Feedbackschleife
Theoretisch produzieren rückverlagerte Fabriken nicht nur Waren – sie erzeugen auch technologische Spillover-Effekte, qualifizierte Arbeitsplätze und lokale wirtschaftliche Vitalität. Im Laufe der Zeit können diese Cluster zu sich selbst verstärkenden Ökosystemen werden. Man stelle sich das Silicon Valley vor, aber für die fortschrittliche Fertigung.
4. Die Vergeltungsvariable
Hier stirbt der Traum oft. Vergeltung ist der reflexartige Gegenschlag in Handelskriegen. Aber im besten Fall reagieren die Handelspartner entweder nicht symmetrisch – oder in Sektoren, in denen die USA weniger zu verlieren haben. „Man braucht Zurückhaltung von anderen und Disziplin im eigenen Land“, sagte ein Handelsexperte. „Das ist eine seltene Kombination.“
Die Kritiker: Nicht nur Skeptiker – fundamentale Gegner
Trotz der inneren Kohärenz der Theorie bleiben Mainstream-Ökonomen zutiefst un überzeugt. Ihre Einwände sind grundlegend: Zölle verzerren die Märkte, Vergeltung ist unvermeidlich, und kein Modell hat jemals langfristige Gewinne durch Protektionismus gezeigt.
„Das ist nicht nur schlechte Politik“, sagte ein Akademiker. „Es ist eine Fehlinterpretation der wirtschaftlichen Schwerkraft. Man kann sich nicht durch Zölle zu Wettbewerbsfähigkeit verhelfen.“
Ihr Argument beruht auf der Geschichte: Vergangene Zollexperimente – vom Smoot-Hawley-Zollgesetz der 1930er Jahre bis hin zu modernen Handelsscharmützeln – haben tendenziell Inflation ausgelöst, globale Allianzen belastet und Konsumenten geschadet.
Wussten Sie, dass der Smoot-Hawley-Zolltarif von 1930 tiefgreifende Auswirkungen auf den Welthandel hatte? Diese protektionistische Politik führte zu einem deutlichen Rückgang des internationalen Handelsvolumens, wobei der Welthandel zwischen 1929 und 1934 um etwa 66 % einbrach. In den USA sanken die Importe im gleichen Zeitraum von 4,4 Milliarden Dollar auf 1,5 Milliarden Dollar, und die Exporte fielen von 5,4 Milliarden Dollar auf 2,1 Milliarden Dollar. Das Gesetz löste Vergeltungszölle von über zwei Dutzend Ländern aus, was den wirtschaftlichen Abschwung weiter verschärfte und zur Schwere der Weltwirtschaftskrise beitrug. Dieses historische Ereignis dient als mahnendes Beispiel für die potenziellen Folgen protektionistischer Handelspolitik auf die globale wirtschaftliche Stabilität.
Darüber hinaus erscheint die Vorstellung, dass US-Unternehmen ohne die Behebung struktureller Probleme wie Gesundheitskosten, regulatorische Komplexität und Fachkräftemangel in sinnvoller Weise rückverlagern werden, den Kritikern naiv.
Zwischen Ideologie und Instrument
Warum also eine Strategie verfolgen, die die meisten Ökonomen ablehnen?
Weil sie die Wirtschaftspolitik als eine Machtausübung und nicht als ein Gleichgewicht darstellt. In diesem Rahmen sind Zölle nicht nur Steuern; sie sind Druckventile, Verhandlungsmasse und Investitionssignale. Sie stellen eine Verlagerung von neoliberaler Passivität zu industriellem Aktivismus dar.
Wussten Sie, dass der Neoliberalismus eine Wirtschaftsphilosophie ist, die sich auf freie Märkte, Privatisierung, Deregulierung und minimale staatliche Intervention konzentriert? Er gewann im späten 20. Jahrhundert unter Führungspersönlichkeiten wie Margaret Thatcher und Ronald Reagan an Bedeutung und befürwortet fiskalische Strenge, Globalisierung und eine Reduzierung der Macht der Gewerkschaften, um die Effizienz und das Wirtschaftswachstum zu steigern. Obwohl er Politiken wie Handelsabkommen und die Deregulierung der Industrie beeinflusst hat, wird der Neoliberalismus oft dafür kritisiert, dass er die wirtschaftliche Ungleichheit verstärkt, die Demokratie untergräbt und ökologische und soziale Belange vernachlässigt. Seine Auswirkungen sind nach wie vor ein heißes Thema in Debatten über moderne Wirtschaftssysteme.
Dies ist keine Rückkehr zum Protektionismus des 20. Jahrhunderts. Es ist ein Versuch, die Nachfrageseiten-Hebelwirkung in einer Welt zu nutzen, in der geopolitische Rivalitäten die Lieferketten umgestalten. Und obwohl es riskant sein mag, argumentieren einige, dass das Risiko selbst Teil der Strategie ist.
„Dreißig Jahre lang haben wir auf Effizienz optimiert“, sagte ein Anlageberater. „Vielleicht ist es an der Zeit, auf Widerstandsfähigkeit zu optimieren – auch wenn das bedeutet, einige alte Modelle zu durchbrechen.“
Eine Renaissance oder eine Fata Morgana?
Es steht viel auf dem Spiel. Wenn die Wette fehlschlägt, zahlen die Verbraucher mehr, Verbündete ergreifen Vergeltungsmaßnahmen, und die Unternehmen passen die Lieferketten einfach an andere kostengünstige Regionen an. Aber wenn die Bedingungen stimmen – wenn die Vergeltungsmassnahmen begrenzt sind, wenn die Einnahmen klug reinvestiert werden, wenn die Rückverlagerung selbsttragend wird –, dann könnte das, was jetzt unplausibel erscheint, transformatorisch werden.
Es ist nicht der wahrscheinlichste Weg. Aber in den Augen seiner Befürworter ist es ein Weg, der es wert ist, erkundet zu werden. Nicht, weil er mit dem Konsens übereinstimmt – sondern gerade weil er es nicht tut.
„Jede Strategie erscheint unmöglich, bis sich die Bedingungen ändern“, sagte ein Analyst. „Und die Bedingungen ändern sich schneller, als wir denken.“
Das letzte Wort
In einer Welt, die zunehmend von Wirtschaftsnationalismus, strategischer Entkopplung und der Neugestaltung von Lieferketten geprägt ist, ist die Zolldebatte nicht länger ein Relikt vergangener ideologischer Auseinandersetzungen – sie ist eine aktuelle Frage der zukünftigen Wirtschaftsarchitektur.
Wer sie ignoriert, tut dies auf eigenes Risiko.
